Newsletter Service
Mit unserem Newsletter erhalten Sie stets aktuelle Hintergrundinformationen über die Energiewirtschaft in Deutschland.
Die Bedeutung von fossilem Gas für den Wärmemarkt wird abnehmen. Andererseits steigt der Einspeisebedarf von klimaneutralen Gasen. Beides hat Konsequenzen für die Netzstrategie der Gasversorger.
Die bestehenden Gasverteilernetze in Deutschland verzweigen sich über eine Länge von mehr als 550.000 Kilometern unter der Erde. Dabei versorgen sie rund 20 Millionen Haushalte und über 1,8 Millionen Gewerbe- und Industriekunden. Mehrheitlich befinden sich die Netze in kommunalem Eigentum. Betrieben werden sie von Stadtwerken und Regionalversorgern. Auf mehr als 270 Milliarden Euro wird der Wiederbeschaffungswert des kompletten Netzes taxiert. Über die Zukunft der Gasnetze gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode sieht vor, dass der Betrieb von Energieinfrastruktur über das Jahr 2045 hinaus nur noch mit
nicht-fossilen Brennstoffen erfolgen soll. Umsetzen möchte die aktuelle Bundesregierung dies über eine All-Electric-Strategie – sie setzt also auf Strom auch in der künftigen Wärmeversorgung. Ob diese Strategie aufgeht, gilt unter Expert:innen als sehr fraglich.
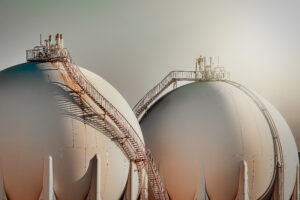
Wenn die wertvolle, bereits bestehende Gasnetzinfrastruktur Bestandteil der Wärmeversorgung bleibt, wäre der Ausbau besser, kostengünstiger und schneller umzusetzen.
Nicht nur sind die damit einhergehenden Maßnahmen teuer. Zudem fehlen Fachkräfte für den Einbau der Wärmepumpen, für die Gebäudesanierung, ohne die das Kalkül nicht aufgeht, für den Ausbau der Stromnetze, die andernfalls an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. „Daher wäre es besser, kostengünstiger und zudem schneller umzusetzen, wenn auch die wertvolle, bereits bestehende Gasnetzinfrastruktur zu einem großen Teil Bestandteil der Wärmeversorgung bleibt“, sagt Patrick Kunkel, Leiter Regulierung bei der Thüga. Dafür gibt es ein weiteres Argument: Die heimische Produktion von klimaneutralem Biogas steigt ohnehin kontinuierlich. Auch dieses Gas muss von Erzeugern zu Verbraucher:innen transportiert werden. Die 550.000 Kilometer Gasnetz würden also nicht überflüssig. Im Gegenteil: Sie liefern auch die Grundvoraussetzung, um eine weitere Treibhausgasminderung durch den Hochlauf einer deutschen Wasserstoffwirtschaft stützen zu können.
Nicht nur bei zahlreichen Detailfragen wartet die Branche noch auf die Antworten. Auch die grundsätzlichen gesetzlichen Vorgaben für die Dekarbonisierung der Gasnetze ab 2045 sind noch ungeklärt. Zahlreiche Belange sind zu berücksichtigen: die der Verbraucher, damit sie nicht durch einen starken Anstieg bei Netzentgelten, hohe Kosten für Heizungsumbau und Gebäudesanierungen finanziell überfordert werden. Die der Gasnetzbetreiber, die aufgrund des Gasheizung-Booms im vergangenen Jahrzehnt in Gasnetzerweiterungen investierten. Die der Stromnetzbetreiber, deren Netze vielerorts durch den Ausbau der Erneuerbaren ohnehin an Kapazitätsgrenzen gelangen. Das Ergebnis, das sich laut Koalitionsvertrag aus dem Dialog mit der Branche ergeben soll, wird maßgeblich sein, damit Versorger den Aus- und Umbau ihrer Netze langfristig kalkulieren können. Eine Festlegung wurde bereits getroffen: Seit 2023 dürfen die Netzbetreiber neue Investitionen in Gasnetze regulatorisch in kürzeren Zeiträumen abschreiben. Statt wie bisher über 45 bis 55 Jahre dürfen sie Investitionssummen für neue Netzinfrastruktur bereits bis zum Jahr 2045 komplett in die Netzentgelte umlegen. Bis mehr Klarheit über den künftigen Rechts- und Investitionsrahmen herrscht, rät die Thüga ihren Partnerunternehmen, die Investitionen in Gasnetze auf sicherheitstechnische Erfordernisse zu reduzieren.
„Es bietet sich an, mögliche technische Änderungen, die für die Aufnahme von Wasserstoff in die Netze nötig sind, dabei gleich mitzuerledigen“, empfiehlt Kunkel. Über die sicherheitstechnischen Erfordernisse hinaus sollten Stadtwerke derzeit allenfalls in eine Verdichtung des Bestandsgebiets investieren, nicht mehr aber in Ortsnetzerweiterungen oder Neuerschließungen. Der Standpunkt der Thüga ist klar: Grundsätzlich hält sie das Vorhaben, die Gasinfrastruktur nach 2045 nur noch mit klimaneutralen Brennstoffen zu betreiben, für sinnvoll. Doch gerade energieintensive industrielle Prozesse wie in der Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Energieversorgungsstrukturen als mit Gas umrüsten. Die Gasleitungen dorthin braucht es also auch weiterhin. An klimaneutralen Gasen wie Biomethan oder grünem Wasserstoff führt daher kaum ein Weg vorbei. Hinsichtlich der CO2-Bilanz kein schlechter Weg, denn diese Gase tragen schon heute spürbar zur Dekarbonisierung der Energieversorgung bei.
Bei allen Detailfragen, die noch zu beantworten sind: Die Transformation der Wärmeversorgung in ein enges Korsett zu schnüren oder auf einen bestimmten Energieträger alleine zu setzen, stellt keine sinnvolle Lösung dar. Vielmehr muss – Stichwort Versorgungssicherheit – die Versorgung auf mehreren Energieinfrastrukturen und -formen fußen. Laut einer Studie von Frontier Economics im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) ist ein solches Energiesystem nicht nur resilienter gegenüber einer rein auf elektrische Energie setzenden Versorgung. Obendrein kommt es volkswirtschaftlich günstiger. Daher favorisiert die Thüga ein technologieoffenes Szenario. Gerade auch, weil die Energieversorgung je nach Region sehr unterschiedlich ist. „Die sichere und praxistaugliche Transformation der Energieinfrastruktur für die künftige Wärmeversorgung lässt sich nur auf Basis lokaler und regionaler Expertise sowie des Bedarfes vor Ort erreichen“, sagt Kunkel. Erst die Technologieoffenheit führt dazu, dass auch wirklich die beste Lösung für die jeweilige Aufgabenstellung das Rennen macht. Eine Gegend, in der viele Gasthermen in unsanierten Altbauten verbaut sind, auf elektrische Wärmeversorgung umzustellen, wäre aus Praktikabilitäts- und Kostengründen wenig sinnvoll. Ebenso sind dem Wärmenetzausbau in sehr ländlichen Gebieten wirtschaftliche Grenzen gesetzt.
Was aber, wenn Brennwertthermen mit Wasserstoff betrieben würden und Gaskund:innen anstelle von fossilem Erdgas sukzessive auf klimaneutrales Gas umsteigen könnten? „Technologieoffenheit bedeutet nicht, dass der Staat keine Anreize setzen kann“, sagt Kunkel. Die hält der Experte sogar für angebracht. Zum Beispiel in Form einer schrittweise ansteigenden Treibhausgasminderungsquote für grünes Gas. „Sie würde die Wasserstoffwirtschaft unterstützen und die Brennstoffe in den Gasnetzen dekarbonisieren. Dadurch wäre eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent im Jahr 2030 möglich.“ Zudem unterstützt die Quote die Nachfrage nach Wasserstoff und Biomethan. Die Folge wäre ein spürbarer Schub für die Transformation der Wärmeversorgung hin zu einem klimaneutralen System. „Derzeit befinden wir uns in einer Übergangsphase, in der Stadtwerke auch im Netzbereich sehr sorgfältig überlegen müssen, wofür sie ihr Geld ausgeben“, fasst Kunkel zusammen. Schon angesichts gesetzlicher Investitionsverpflichtungen für den Anschluss von EE-Anlagen, Ladeinfrastruktur sowie weiterer steigender Anforderungen sind Investitionen im Stromnetz grunsätzlich sinnvoll angelegt. „Doch sobald klarer wird, wohin der Weg in der künftigen Wärmeversorgung geht, müssen die Stadtwerke gemeinsam mit den Kommunen die Gegebenheiten und Bedürfnisse vor Ort und daraus abgeleitet ihre Investitionsstrategie neu bewerten.“